Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst
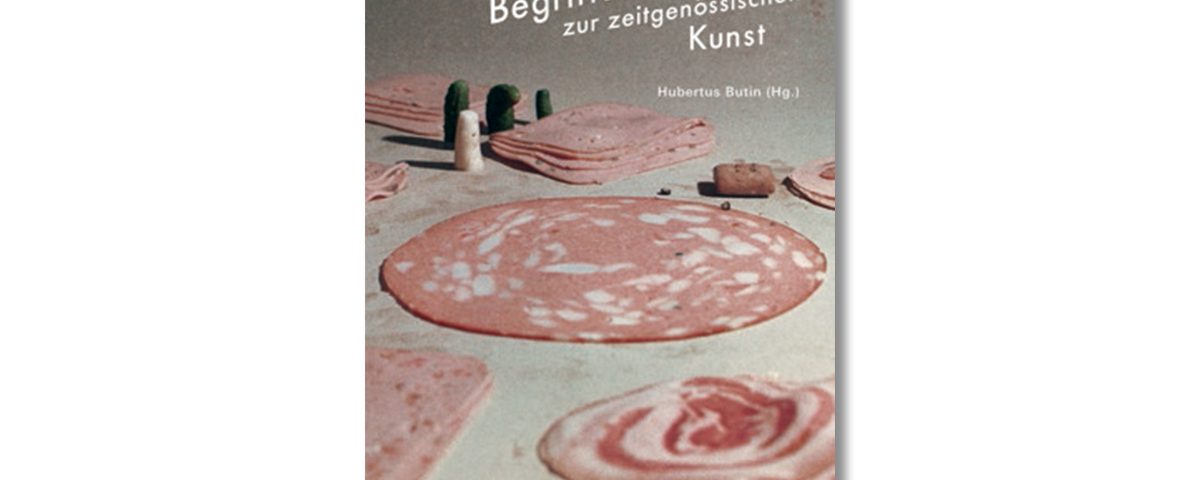
Ein alternativloses Standardwerk für den deutschsprachigen Raum
Wer einen fundierten Einblick in aktuelle bzw. noch immer aktuelle Begriffe, Diskurse und Strömungen der Kunst seit 1960 sucht, der greife zu dem von Hubertus Butin herausgegeben Begriffslexikon. Die zunächst 2002 und 2006 bei DuMont erschienenen, lange vergriffenen Auflagen belegen, dass das Nachschlagewerk in privaten wie öffentlichen Bibliotheken angekommen ist und sich dort bewährte. Die nun seit 2014 vorliegende 3. Ausgabe wurde noch einmal überarbeitet, um 19 Einträge erweitert und um neuere Literaturhinweise ergänzt. 87 Stichworte von 59 Autoren in Form von Kurzaufsätzen vorgestellt, 150 Schwarzweiß-Abbildungen, ein Namens- und Begriffsregister, dies alles für knapp 25€. „Unverzichtbar!“ titelt die Homepage des nun verantwortlichen Snoeck-Verlags und mag damit nicht Unrecht haben. „Alternativlos“ ließe sich angesichts der fehlenden Konkurrenz auf diesem Gebiet ebenfalls sagen. Liegt es einzig an den inzwischen im Internet abrufbaren Glossaren und „Wikis“, dass das Format Lexikon auch für Verleger zu einer „undankbaren“ Aufgabe wurde? (Für den deutschsprachigen Raum wäre hier noch Kunst-Begriffe der Gegenwart. Von Allegorie bis Zip, erwähnenswert, das 2013 erschienen ist und in bewusster Ergänzung zu dem damals vergriffenen Begriffslexikon bis dato weniger fokussierte Begriffe vorstellt.) In dieser Hinsicht muss man Butin und seinen über die Jahre wechselnden Verlegern wie Autoren Dank aussprechen.

Um einen Bewertungshorizont zu gewinnen, mag ein Blick in das Vorwort hilfreich sein. Der Herausgeber konstatiert in ihm „eine immer ausgeprägtere Diskursbildung [...], die ein breiteres Wissen und erhöhtes Theoriebewusstsein erforderlich macht“. Mit dem vorliegenden Lexikon möchte man dieses zugänglich machen und hat „führende Theoretikerinnen und Theoretiker unserer Zeit“ angefragt, die „Kunstentwicklung von 1960 bis heute“ in „prägnanten Essays“ zu „beschreiben, analysieren und bewerten“. Was einen führenden Theoretiker heute als solchen kennzeichnet und wo bzw. wie sich in der schönen neuen Projekt- und Netzwerkwelt (Luc Boltanski) die Trennung zwischen Theorie und Praxis ziehen ließe, bleibt ungeklärt. Die 59 Namen im Inhaltsverzeichnis stehen eher für einen ausgewogenen Mix aus vornehmlich Kunsthistorikern, welche die unterschiedlichsten Rollen und Positionen innerhalb des Betriebssystems Kunst – diese Bezeichnung ist im Lexikon leider nicht anzutreffen – einnehmen. Und auch die ausgewählten Begriffe lassen keinen vorrangig theoretischen Fokus erkennen: Von „klassisch“ kunsthistorischen Labeln wie z.B. „Pop Art“ (Barbara Hess), „Appropriation Art“ (Stefan Römer), „Fluxus“ (Gabriele Knapstein) oder „Bad Painting“ (neu, Hans-Jürgen Hafner) über rahmende Phänomene wie „Cultural Studies“ (Tom Holert), „White Cube“ (Christian Kravanga), „Archiv“ (Regina Schultz-Möller) und „Künstlerbuch“ (neu, Michael Diers) bis in die Theorie zielende Begriffen wie „Dekonstruktivismus“ (Heinrich Wefing), „Hybridität“ (Christian Höller), „Index“ (neu, Friederike Wappler), „Postkoloniale Blick“ (Christian Kravanga) oder „Postmoderne (Oliver Elser). Auch hier zeichnet sich das Lexikon eher durch einen guten Querschnitt denn theoretischen Zugriff aus. Ein Manko? Gar nicht.
Inwiefern eine begriffliche und theoretische Zuspitzung im Zeitgenössischen schwerfällt, zeigen die vielen K-Einträge: In bester Kunstforum-International-Manier stößt der Leser dort auf zahlreiche „Kunst und“-Formulierungen. Um nur die 2014 hinzugekommenen zu nennen: „Kunst und Design“ (Kathrin Busch), „Kunst und Globalisierung (Julia Gelshorn), „Kunst und Wissenschaften“ (Susanne Witzgall), „Kunst und Politik im frühen 21. Jahrhundert“ (Kerstin Stakemeier) und, leicht abweichend, „Künstlerische Forschung in akademischen Institutionen“ (Elke Bippus). Hier werden seitens der Autoren parallele Bereiche, Spannungsfelder und Schnittmengen überblicksartig beschrieben, das „Problem der Definition“ (Butin im Vorwort) zwar ab ovo umgangen, aber fundierte Einblicke in virulente bzw. immer wieder aufkeimende Debatten geboten. Ein größeres Manko im Hinblick auf Ausgewogenheit und Objektivität scheint dagegen, dass die knapp 90 Beiträge von 59 Autoren verfasst wurden. Die Einbeziehung möglichst vieler, auch aus Nachbarländern stammenden oder außerhalb Europas arbeitenden Autorinnen hätte eine breitere, polyfokale Sicht garantiert. Dass die Publikation seinen Lesern an keiner Stelle Informationen über die Autoren, sondern lediglich über den Herausgeber an die Hand gibt, könnte als unreflektierte Haltung gegenüber dem Format Lexikon und der eigenen definitorischen Macht gedeutet werden. Aber diese „Infos“ lassen sich heute ja auch im Internet recherchieren.
Erfreulich sind die vergleichsweise vielen Einträge zur Fotografie, für die u.a. mit Hubertus von Amelunxen, Timm Starl und Stefan Gronert ausgewiesene Kenner gewonnen werden konnten. Von Amelunxens Essay zur „Digitalen Fotografie“ ist nach wie vor lesenswert, verweist mit Barthes und Flusser auf klassische Marksteine innerhalb der (ehemaligen) Analog-vs-Digital-Grabenkämpfe und zeigt auf, inwiefern die technischen Veränderungen ein neues Nachdenken über Wahrnehmung, Wahrheit oder Wirklichkeit erfordern. Eine verpasste Chance ist es jedoch, dass der schon 2002 verfasste Artikel für die neue Auflage nicht überarbeitet bzw. lediglich um eine Fußnote ergänzt worden ist. Bilddistribution innerhalb sozialer Netzwerke oder 3D-Drucker, um nur zwei Stichworte zu nennen, sind somit noch kein Thema. Und auch den im Text angesprochenen Werken und Künstlern hätte die Ergänzung um aktuelle Beispiele gut getan. Obgleich noch immer lesenswert und informativ, merkt man dem Text seine Zeitgenossenschaft an – und diese liegt nun über eine Dekade zurück. Aus Achtung vor einem verdienten Professor, Kurator und Autor, der grundlegend zur Fototheorie publizierte und wichtige Ausstellungen zur digitalen Fotografie verantwortete, sowie aus wissenschaftlicher Redlichkeit hätten die Verantwortlichen das Entstehungsdatum dieses und der übrigen Texte mit abdrucken müssen. Ein Fauxpas, den man auch als Etikettenschwindel auslegen könnte, wenn man neuen Wein mit altem mischt und unter dem Label „zeitgenössisch“ herausbringt. „Heuriger“ liest sich dagegen der neu hinzugekommene Artikel von Stefan Gronert zur „Düsseldorfer Fotoschule“. Es ließe sich fragen, ob der Fotoklasse von Bernd und Hilla Becher in einem allgemeinen Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, in der der Bereich der Videokunst pauschal auf wenigen Seiten abgehandelt wird, ein eigener Beitrag zukommen muss. Der Text an sich liest sich jedenfalls prägnant und informativ. Gronert fasst nicht nur die historischen Umstände und Protagonisten zusammen, er führt auch ihre stilistischen, technischen sowie strategischen Besonderheiten auf und schreckt vor dem Verweis auf die Marktliaison der „Struffskys“, ein Neologismus aus den Namen Thomas Struth, Thomas Ruff und Andreas Gursky, nicht zurück. Abschließend reflektiert er die wissenschaftliche Fundierung des „Etiketts“ Düsseldorfer Fotoschule und kommt zu dem Fazit: „In seiner kunsthistorischen Tragweite scheint das Etikett […] nur für einen sehr begrenzten Zeitraum sinnvoll zu sein.“
In der Sparte der „Kunst und“-Konstruktionen finden sich sehr konzentrierte neben sehr überfrachteten Aufsätzen. Unter der Weite der Themenfelder leidet vielfach die Anschaulichkeit, da es nicht immer gelingt, sowohl historische wie kulturgeschichtliche Zusammenhänge und Entwicklungslinien zu erklären, als auch künstlerische Annäherungen und Werke anschaulich zu beschreiben. Wer die vielfach nur anzitierten Namen und zugehörigen Arbeiten nicht kennt oder im Internet recherchiert, kann lediglich allgemeine Tendenzen nachvollziehen, der Übertrag ins Künstlerische bleibt schemenhaft. Beeindruckend dagegen, wie Diedrich Diederichsen das Begriffspaar „Kunst und Ökonomie“ angeht. Auf hohem Niveau und aus der Vogelperspektive legt er dem Leser gedankliche Zugänge, beschreibt die „Welt der Kunst neben der der Gerechtigkeit, der Liebe und anderen außerordentlichen Wertsphären als eine außerökonomische“, in der jedoch „der Wert des Kunstwerks ganz von einem schwer durchschaubaren Markt ausgehandelt“ wird. Seine Vergleiche zu Börsengeschehen, Religion, Soldaten und Ärzten helfen auch kunstfernen Lesern Wert(e)-Paradoxien zu verstehen. Von Svetlana Alpers Rembrandt als Unternehmer führt er uns im Galopp durch die Jahrhunderte bis zu den Young British Artists, ohne dabei zu viele Haken zu schlagen oder den roten Faden aus der Hand zu geben. Ebenso beeindruckend gelingt es Julia Gelshorn in ihrem 2014 neu hinzugekommenen Artikel zu „Kunst und Globalisierung“, den „Globalisierungsdiskurs im Allgemeinen“ anzudeuten, kritisch den Link zu wirtschaftlichen Prozessen und der „Biennalisierung“ im Ausstellungsbetrieb deutlich zu machen und einzelne transkulturelle Arbeitsweisen von Künstlerinnen vorzustellen – wobei der sehr dichte und auf vielen Ebenen argumentierende Text bestimmt keine leichte Kost ist. Ihr abschließender Satz, der den westlich geprägten Kunstdiskurs in Frage stellt, könnte, wie bezüglich der Autoren- und Begriffsauswahl bereits angedeutet, auch kritisch auf das Begriffslexikon angewendet werden: „Die Herausforderung einer ‚globalen Kunstgeschichte‘ besteht daher künftig darin, der asymmetrischen und polyzentrischen Welt gerecht zu werden (Juliane Rebentisch), indem der westliche Kunstdiskurs sich selbst relativiert oder ‚provinzialisiert‘ (Dipesh Charkabarty) und sich der Geschichte einer ‚verwobenen Moderne‘ (Shalini Randeria) stellt.“
Viele weitere anregende Beiträge, die Butins Lexikon im handlichen Format versammelt, wären zu nennen: Sebastian Egenhofer über „Minimal Art“, Stefan Römer zu „Fake“, „Postkoloniale Blicke“ von Christian Kravagna, Julia Gelshorn zu „Künstlerinterviews“, Michael Diers zum „Künstlerbuch“ usw. Dass die 2014er Auflage um drei ältere Textbeiträge gekürzt wurde, ist gerade im Hinblick auf Butins Essay zum „Kultursponsoring in Deutschland“ ein Verlust. Der so kritische wie detailreiche Aufsatz hinterlässt eine bedauernswerte Lücke. Und doch: Trotz einiger Schwächen – weshalb wurde in der Allgegenwart der Hypertexte weitestgehend auf Verweise zwischen den Artikeln verzichtet? – handelt es sich um ein alternativlos unverzichtbares Standardwerk für den deutschsprachigen Raum. Es ist zu empfehlen, wenn man sich für die jüngere Bildende Kunst und ihre Geschichte interessiert und es nicht als Einstiegslektüre sondern als Nachschlagewerk und Orientierungshilfe begreift. Die neue, „herzhafte“ Coverabbildung aus der Wurstserie von Peter Fischli und David Weiss sowie die 19 hinzugekommenen Artikel legitimieren die Neuauflage des ansonsten leider zu wenig überarbeiteten bzw. überdachten Lexikons. Ohne unken zu wollen, sei die These gewagt, dass es dessen letzte, redigierte Ausgabe sein wird. Zu wenig wird hier das Format Lexikon in Zeiten vernetzten Denkens und Recherchierens hinterfragt, zu wenig stellt man sich der Herausforderung, zu wenig weiß man sie für sich zu nutzen. In dieser Hinsicht wirkt das Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst leider wenig zeitgenössisch oder gar zukunftsweisend.
Die Rezension erschien in abgewandelter Fassung bereits bei sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geisteswissenschaften: www.sehepunkte.de/2016/03/26592.html



